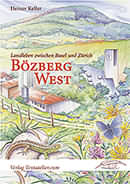DER KRIEG, DAS SIND WIR SELBST
Autor: Wernfried Hübschmann, Lyriker, Essayist, Hausen im Wiesental
Über die Tapferkeit vor dem Freund
Versöhnung ist mitten im Streit.
Hölderlin, Hyperion (II)
Der Zweifel als die große moralische Gabe, die der Mensch der Sprache verdanken könnte und bis heute verschmäht hat, wäre die rettende Hemmung des Fortschritts, der mit vollkommener Sicherheit zu dem Ende einer Zivilisation führt, der er zu dienen wähnt.
Karl Kraus (1932)
Wenn wir die Müdigkeit
abschütteln und den Blick schärfen und uns nicht blenden lassen von den eigenen Hoffnungen, die immer Ausdruck tiefer Resignation sind, dann sehen wir: Die „Nachkriegszeit“ ist zu Ende. Der lauwarme Krieg ist zu einem heißen geworden. Und damit meine ich nicht denjenigen, den Emmanuel Macron bereits im April 2020 leichtfertig gegen das Corona-Virus ausgerufen hat: „Nous sommes en guerre!“ Sondern ich meine den konkreten, den schrecklichen, den alles Menschliche verachtenden Krieg in der Ukraine.
Ingeborg Bachmanns Gedicht
„Alle Tage“ beginnt so: „Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt“. Ja, wir befinden uns heute, im Jahr 2022, im Krieg, der, nüchtern betrachtet, nie aufgehört hat zu wüten. Ich könnte auch andere Kriegsschauplätze nennen: Syrien, Mali, Afghanistan, Mexico, Tibet, Türkei, die USA, Myanmar. Vermutlich müsste ich auch Deutschland nennen, trotz der Reststabilität unserer demokratischen Institutionen, trotz des Grundgesetzes, dessen Bewunderer ich unverdrossen bin, trotz des Vertrauens in die Kraft aufgeklärten und selbstbewussten Denkens, wie wir sie seit dem frühen 18. Jahrhundert üben und üben. Wir üben noch, von „Können“ kann keine Rede sein. Es ist unmöglich, beim Nachdenken über Krieg und Frieden den Krieg gegen die Natur auszublenden, die Ausbeutung der Primärressourcen, das brutale Abholzen des Regenwaldes, die Verschmutzung der Landschaften, Gebirge und Flüsse, die Verrohung auch der Gemüter, all die Ungerechtigkeiten, die Gier und den Wahnsinn und die unzähligen Formen sozialer und psychischer Gewalt zwischen den Menschen. Über Empathie wird nur deshalb so viel geschrieben, weil sie im praktischen Leben eher ein Anspruch ist denn eine Wirklichkeit. Sie wird beschworen, weil sie fehlt. Und weil uns sogar für die Beschreibung der aktuellen Weltlage die Begriffe fehlen, wie der Osteuropa-Historiker und Essayist Karl Schlögel schon 2014, nach der Annexion der Krim durch Russland, schrieb: „Alles ist denkbar geworden, und eine von einer langen Nachkriegszeit friedensgewohnte und friedensverwöhnte Generation muss sich auf eine Wirklichkeit einstellen, für die sie – vorerst jedenfalls – die Begriffe nicht hat.“ Wenn die Begriffe noch fehlen, so sollen doch die Worte nicht gänzlich fehlen, auch wenn sie tasten und taumeln und nach einer angemessenen Sageweise suchen müssen. Jede neue historische Situation bedarf einer eigenen Sprache, einer Schreib- und Sprechweise, die ihrerseits eine Antwort sein muss auf die gestellten Fragen – und, noch wichtiger, auf die ungestellten Fragen, die aus der Zukunft erst auf uns zurollen.
Wie sähe er denn aus,
dieser Frieden, von dem alle reden und der doch eine sehr gebrochene und brüchige Idee von etwas ist? Frieden muss ja mehr sein als die Abwesenheit von Krieg. Er ist nicht als der „Ewige Friede“ zu haben, von dem Immanuel Kant spricht. Er ist also kein „Zustand“, sondern vielmehr ein Prozess, eine Entwicklung, die in jedem einzelnen Schritt sich ihrer Gefährdung bewusst ist und sie einarbeitet in den historischen Gang der Dinge. Wir dürfen die Idee des Friedens also nicht objektivieren als eine Vorstellung außerhalb von uns. Wir sollten uns fragen, welche inneren Prozesse den Frieden repräsentieren. Woran würde ich ihn erkennen? An vollen Badestränden, lachenden Kindern, einer prosperierenden Wirtschaft? Welche Phänomene zeigen uns praktischen Gefährdungen und theoretischen Risiken auf, das Gebirge menschlicher Abgründe. Die Frage nach dem Frieden ist eine anthropologische Fragestellung, die in ihrer Unbeantwortbarkeit weitere Fragen hervorbringt und neue Facetten des Nachdenkens über Krieg und Frieden. Kriegerische Interventionen werden „Friedensmissionen“ (Balkan-Konflikt) genannt, die Bataillone heißen „Friedenstruppen“ (deutsche Soldaten in Mali) und offene Aggressionen (Ukrainekrieg) werden als „Sonderaktionen“ euphemistisch bemäntelt. Diese Umdeutung historischer Begriffe ist ein wesentlicher Aspekt des Kriegerischen selbst. Wer die Wörter besetzt, besetzt auch ein Land. Man lese das „Wörterbuch des Unmenschen“ (Sternberger, Storz, Süskind, 1957). Die Nicht-Benennung des Mords als „Säuberungen“, die Dehumanisierung und Abwertung der „Gegner“ als „Nazis“, „Verbrecher“, „Verräter“, „Abschaum“ oder „Untermenschen“ nimmt in der Sprache die Gewalt vorweg und sucht sie gleichzeitig zu legitimieren. Anders gesagt: Intentionalität und Mentalität treten in Sprache und Rhetorik am klarsten und deutlichsten zutage. Wir müssen nur genau hinhören. Die Sichtbarkeit des Krieges besteht in Machtdemonstrationen (Militärparaden, Flugschauen) und Herrschaftsgesten (Paläste, Prunk und Pomp) und nicht zuletzt im aggressiven Anspruch auf die Deutungshoheit der Ereignisse, was sich politisch als Zensur, Einschränkung der Meinungsfreiheit und der offenen Unterdrückung Andersdenkender zeigt, etwa nach innen in der Kriminalisierung und Verfolgung der politischen Opposition und nach außen im Verdikt gegenüber der „Einmischung in innere Angelegenheiten“. Eine Argumentationsstrategie, die Bedeutung und Einfluss supranationaler Organisationen (EU, UNO) massiv eindämmt oder gar unmöglich macht. Die Frage nach dem Frieden ist eine Frage nach der Lebenswirklichkeit, nach der Toleranz gegenüber den anderen Formen des Denkens und Glaubens, nach der „Tapferkeit vor dem Freund“, wie es im genannten Bachmann-Gedicht heißt. Frieden ist ein Plädoyer für Vielfalt, für soziale und politische Diversität, für das Loslassen des Anspruchs auf „Rechthaben“ und ethnische Überlegenheit. Und: Frieden ist ohne Freiheit nicht zu haben. Diese Einsicht gehört in den Grundbestand westlich-liberaler Demokratien. In den Worten Hannah Arendts: „Freiheit ist stets die Freiheit der Andersdenkenden“.
Der berühmte Romantitel
von Lew Tolstois benennt ja Krieg UND Frieden. Nun, da wir uns auf dem Weg sehen in einen Krieg aller gegen alle, gilt es, die Frage zuzuspitzen: Krieg ODER Frieden? Denn für Frieden zu sein, ist eine moralische Selbstverständlichkeit. Umso komplizierter gerät die Antwort auf die Frage, wie sich Krieg verhindern ließe. Denn in dieser Frage tritt uns mit ganzer Schärfe und Härte die Einsicht entgegen, dass wir die Frage nach dem Menschen, die Frage nach uns selbst, unserem Selbst- und Weltverhältnis, im 21. Jahrhundert neu und anders stellen und neu und anders werden beantworten müssen. Diese Antwort gibt es noch nicht. Sie wird sich entwickeln aus den Veränderungen des Alltags, aus Einsicht und geistiger Tätigkeit (das wäre wünschenswert), aus Lernen von der Geschichte (die ja wie ein offenes Buch vor uns liegt), aus persönlichem Schmerz und Leid (was am wahrscheinlichsten ist). Sie wird sich finden vor allem in der Frage, wovon wir uns verabschieden müssen, von welchen Illusionen, Wahrnehmungsverzerrungen und Selbstbetrügereien im Blick auf unsere Seinskonzepte, unsere Pläne und unser praktisches Leben. Abschied nehmen? Ja, vom Luxus der Friedensgewissheit. Wir müssen in den Spiegel schauen. Und wir werden dabei nicht nur uns selbst auf verstörende Weise (wieder)erkennen, sondern auch jeden, der jemals ein Gegner oder gar „Feind“ genannt werden könnte – und doch nur das Spiegelbild unserer eigenen Innenwelt ist: der Andere und das Andere, ohne das die eigene Identität nicht denkbar und nicht fühlbar ist. Der Schatten, das Monster, der Dämon, die andere Seite von uns, die „dunkle Seite der Macht“, die wir nur bändigen werden, wenn wir ihr ohne Furcht in die Augen schauen. Wenn wir sie psychologisch und politisch-systemisch integrieren, annehmen, akzeptieren, transformieren und in Liebe verwandeln.
Das Sprechen
über Frieden wird erst konkret, wenn wir erklären, wie wir leben wollen. Und wenn wir die „Anderen“ so leben lassen, wie sie wollen. Das ist die selbst gestellte Aufgabe, die individuelle Seite des Politischen. Erst dann kommt die komplizierte Frage nach 5 Grenzen, Zöllen und dem Wandel durch Handel. Unsere Aufgabe ist es, dem Frieden den Boden zu bereiten, damit der wachsen und gedeihen kann. Solange in unseren eigenen Köpfen und Herzen Unfrieden wohnt, wird auch im Außen kein Frieden sein und bleiben können. Denn: Der Krieg, das ist der Krieg in uns. Der Krieg: das sind wir selbst.
Wernfried Hübschmann ,Hausen im Wiesental, im April 2022
Hinweis auf weitere Blogs von Hübschmann Wernfried
FRAGESTUNDE
Kolumnen: Neues aus der Hebelstraße, Folge II/2022
Kolumnen: Neues aus der Hebelstraße, Folge I/2022
DER KRIEG, DAS SIND WIR SELBST
Kolumnen: Neues aus der Hebelstraße, Folge V
Kolumnen: Neues aus der Hebelstraße, Folge IV
Kolumnen: Neues aus der Hebelstraße, Folge III
Kolumnen: Neues aus der Hebelstraße, Folge II
Kolumnen: Neues aus der Hebelstraße, Folge I
ALLER WELT ANGST
GEDULDSPROBEN
Der Tag, an dem mir die Bibel auf den Kopf fiel
Glosse: Zum Abschied tote Fische *
Kritische Notiz zur Corona-Wirklichkeit*